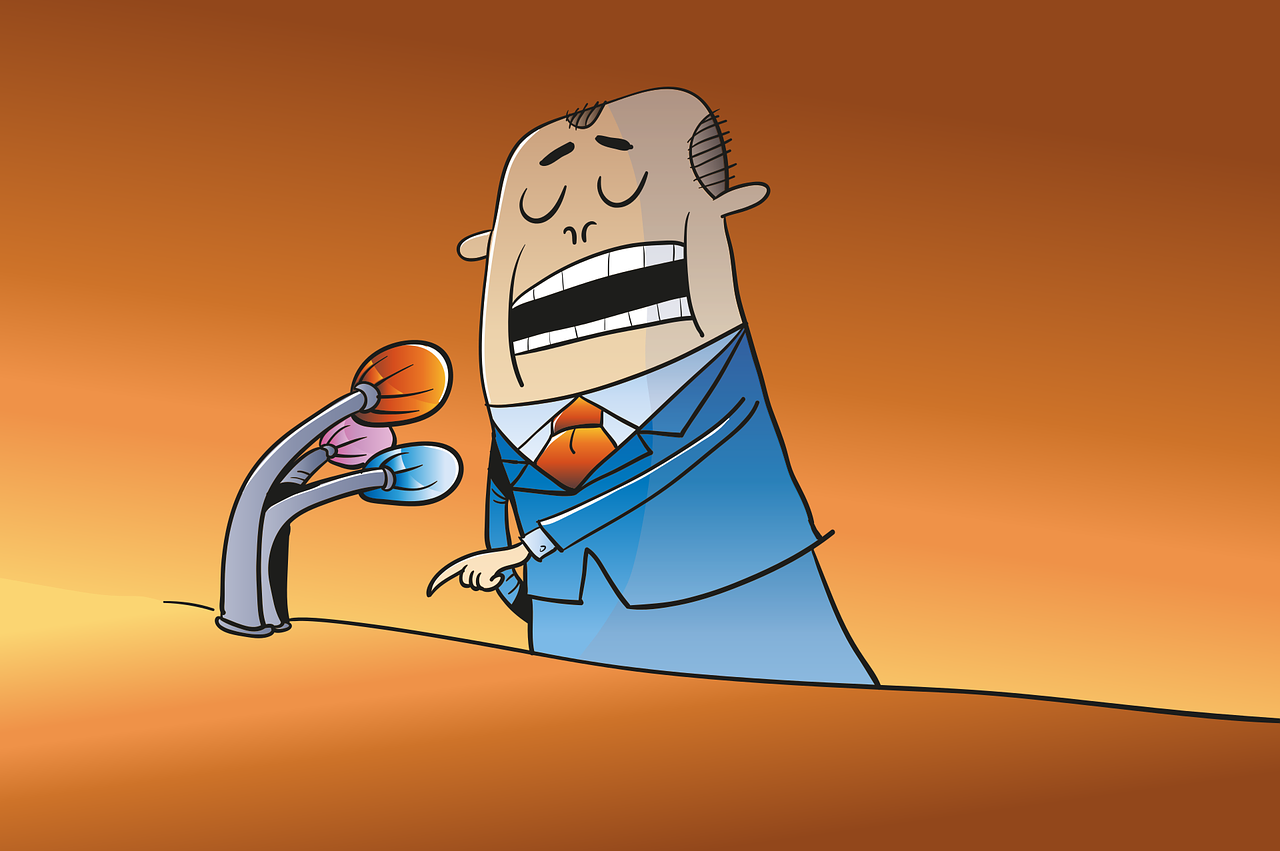Eine kleine Philosophie vom richtigen Zeitpunkt
Die Zeit ist unerbittlich - schlechtes Timing: zu früh oder zu spät

Gibt es so etwas wie eine Philosophie vom richtigen Zeitpunkt? Jeder kann in seiner Biographie selbst herumgraben und dann nach reiflicher Überlegung zu dem Ergebnis kommen, dass er etwas versäumt hat zu tun, als die Zeit dafür reif war oder dass er zu voreilige Entscheidungen getroffen hat, die ihm dann einiges verbaut haben.
· Die Unerbittlichkeit der Zeit: Es mag das Los der diesseitigen Welt sein – im Jenseits soll es so etwas wie Zeit, zumindest noch unserem Verständnis, nicht geben [1] – dass wir der Zeit unbarmherzig unterworfen sind. Kein Mensch hat es bisher geschafft, die Uhren anzuhalten, naja, nicht buchstäblich gemeint, denn selbstverständlich kann ich eine Uhr anhalten, indem ich z. B. bei einer elektronischen Uhr die Energiezufuhr unterbreche. Aber dadurch halte ich nur die angezeigte Zeit an, nicht aber die tatsächliche Zeit. Bereits mit der Geburt ist der Tod vorprogrammiert. Es ist wie mit einer mechanischen Uhr, die man aufzieht: Wenn die Feder sich völlig entspannt hat, dann bleibt die Uhr unweigerlich stehen. Und so scheint es auch mit unserem Leben zu sein, denn die Zeit, die uns zum Leben bleibt, ist gewissermaßen vorgegeben. Wir können also kein Leben verlängern, sondern nur verkürzen. Die Lebensverlängerung ist also eine Riesentäuschung, der wir unterliegen. Wenn Ärzte davon sprechen, sie hätten mit ihrer Therapie erreicht, dass das Leben noch einmal verlängert wurde, dann ist das einfach nicht wahr, sie haben lediglich erreicht, dass die Lebensuhr nicht frühzeitig zum Stehen kam. Was wir tun können ist, das Leben zu verkürzen. Dies geschieht durch alle Maßnahmen, die vergleichbar wären mit einem Sabotageakt, bei dem eine Maschine gewaltsam zerstört wird oder mit einem Stören des eigentlich reibungslosen Ablaufs des Getriebes, indem man sprichwörtlich „Sand in das Getriebe“ wirft, sodass irgendwann die Maschine zum Stillstand kommt. Die Uhr des Lebens tickt also unablässig weiter und zwar nur in eine Richtung, nämlich in die Zukunft, bis sie irgendwann zum Stehen kommt. Die Zeit anzuhalten, um etwas korrigieren zu können, ist der Traum vieler Menschen. Denn dann könnten wir in der Zwischenzeit etwas gerade rücken, was schief gelaufen war [2] . Dieses Stehenbleiben der Zeit taucht schon in dem Märchen von Dornröschen auf. Dort fällt sie – aber auch der ganze Hofstaat des Königs – als sie sich mit 15 Jahren mit einer Spindel stach, in einen hundertjährigen Schlaf. Dieses Märchen hat schon alle möglichen Interpretationen erfahren, die vor allem oft sexueller Natur waren [3] , aber interessant ist das Stehenbleiben der Zeit, oder man müsste genauer sagen, die Unterbrechung aller Handlungen der Akteure im Königshaus, die genau dann wieder einsetzten, als der Kuss des Prinzen die Königstochter wieder zum Leben erweckte. Es ist so, als gäbe es zwei Ebenen, auf denen die Geschehnisse passiert sind: Die Ebene des in den Schlaf gefallenen Mädchens und die unmittelbare Welt um sie herum und die Ebene, auf der die Prinzen agierten, die vergeblich versuchten, durch die Dornenhecke einzudringen bis dann der richtige Prinz kam. Die Idee von zwei verschiedenen Zeitebenen war geboren und damit auch die Vorstellung von der Zeit, die nicht für alle in gleicher Weise verläuft [4] .
· Richtiges Timing: Wenn wir den richtigen Zeitpunkt abpassen, zu dem eine Entscheidung getroffen wird, dann spricht man auch auf Neudeutsch vom „richtigen Timing“. Einen Witz kann man verderben, indem man die Pointe zu früh bringt. Zu jedem Ereignis gibt es den richtigen Zeitpunkt – oder aber den unpassenden, der alles verdirbt. Die Liebeserklärung bedarf genauso eines richtigen Zeitpunktes wie der Schuss aufs Tor eines Elfmeterschützen auf dem Fußballplatz, damit der Torhüter „auf dem falschen Fuß erwischt“ wird und der Ball ins Tor geht. Es gibt zwei Varianten eines falschen Timings: das zu früh und das zu spät.
- Zu früh: „Zu früh gefreut“, sagt ein altes Sprichwort, wenn jemand voreilig glaubt, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der Spruch „nur wer zuletzt lacht, lacht am besten“ [5] bringt es auf den Punkt. Wer glaubt, bereits am Ziel zu sein und sich königlich amüsiert, dass anderen ein Missgeschick passiert ist oder er es geschafft hat, einen Gegner durch einen Trick reingelegt zu haben, kann sich eben gewaltig irren. Zu früh irgendwo ankommen, ist auch nicht erfreulich, weil dann das endlos erscheinende Warten angesagt ist. Dieses Warten wird deshalb als ätzend empfunden, weil jeder denkt, dass er in dieser Zeit etwas Sinnvolleres hätte tun können. Das „Warten auf Godot“ von Samuel Becket [6] ist das vergebliche Ausharren auf die Begegnung mit den „kleinen Gott“, Gott des Absurden, Sinnlosen und Trostlosen [7] . Die Lebenslänge kann man künstlich verkürzen, indem man sich das Leben selbst nimmt, dann stirbt man zu früh. Es gibt den abrupten „Selbstmord “ [8] , indem man sich eine Kugel in den Kopf jagt, sich aufhängt, sich von einer Brücke stürzt u. ä., aber auch den sukzessiven „Selbstmord“ , also das allmähliche Selbsttöten durch allerlei ungesunde Angewohnheiten. Hierzu zählen übermäßiger Genuss von Alkohol, Nikotin, Kokain, Marihuana oder andere Drogen bis hin zur Völlerei oder aber das simple faul in der Ecke liegen, also der Bewegungsmangel. In dem Film Nosso Lar, in dem der Arzt Dr. André Luiz nach einem inoperablen Magendurchbruch ums Leben kam und er in den finsteren Gefilden des Jenseits aufwachte, galt er als „Selbstmörder“, weil „bestimmte Formen der Ausschweifung wie Wut, Zorn, Hass, Gier und Begierde, Selbstsucht und Stolz, Neid und Völlerei, Materialismus und dergleichen gleichbedeutend mit Selbstmord sind“ [9] . Wer sich das Leben nimmt, kommt im Jenseits zu früh an, er kommt zur Unzeit an, war noch nicht erwartet. Diejenigen, die nach einem Selbstmordversuch eine Nahtoderfahrung hatten, berichten, dass sie nach ihrer Wiederbelebung zu der Einsicht gekommen waren, dass es ein Fehler war [10] . Idealerweise stirbt man dann, wenn der „ Seelenplan “ [11] erfüllt worden ist. Dieser Plan der Seele entspringt ihren Vorbereitungen im Jenseits vor einer Inkarnation. Er beinhaltet zwei Komponenten: Der Ausgleich dessen, was in dem(n) Vorleben versäumt wurde (Abbau des negativen Karmas) und die Planung neuer Aufgaben nach vorgesteckten Zielen (Aufbau positiven Karmas). Das Karma ist nach fernöstlichen Lehren (Hinduismus, Buddhismus) die Folge unseres Tuns, das uns nach dieser Vorstellung einer absoluten Gerechtigkeit unterliegt, wonach alles Handeln oder Unterlassen eine positive oder negative Konsequenz hat. Scheidet man zu früh aus dem irdischen Leben, dann wird eine Inkarnation mutwillig vorzeitig beendet und dadurch die Erfüllung des Seelenplans ver-oder behindert.
- Zu spät: In dem Spruch „wer nicht kommt zur rechten Zeit, der bekommt was übrig bleibt“, bringt das Zuspätkommen auf den Punkt. Wenn etwas zur Verteilung ansteht, ist es ratsam, rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein, um auch in einer günstigen Position zu sein. Wer zu spät am Bahnsteig ankommt, verpasst den Zug, auch wenn es nur Sekunden sind. Wer zu einem verabredeten Zeitpunkt nicht erscheint, verärgert den anderen. Es stellt eine Belastung für jeden zivilisierten Menschen dar, auf jemand unnötig zu warten. „Wer zu spät kommt, den straft das Leben“, ist ein weiterer Spruch, der fälschlicherweise Gorbatschow zugeschrieben wurde anlässlich seines Staatsbesuches in der DDR im Jahr 1989, der aber auf den außenpolitischen Sprecher des letzten Präsidenten der UdSSR und seines Außenministers, Gerassimow, zurückgeht [12] . Die Anspielung ging an den letzten SED-Machthaber Honecker, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hatte, wodurch er seinen Sturz durch die friedliche Revolution in der Ex-DDR verursacht hatte. Das nicht rechtzeitige „Abdanken“ eines Machthabers gilt seit ewig als ein häufig anzutreffender Fehler eines Herrschers oder Amtsinhabers, was irgendwann zu seinem Verhängnis wird. Das Festklammern an der Macht verhinderte 1998 wahrscheinlich einen abermalige Amtszeit von Helmut Kohl, der nicht rechtzeitig erkannt hatte, dass er das Zepter an einen Nachfolger (Wolfgang Schäuble) hätte abgeben müssen [13] . Wenn man die wirkliche Dimension des Zuspätseins erfassen will, ist es wichtig, die unterschiedlichen Qualitäten von Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden. Der nach unserem Sprachgebrauch noch übliche Begriff der Gegenwart ist im Grunde genommen völlig daneben, denn es gibt eigentlich gar keine Gegenwart: Sobald ich diese Worte geschrieben habe, ist der Schreibvorgang bereits Vergangenheit. Nur für den Bruchteil einer Sekunde existiert diese Gegenwart, verschwindet aber sofort im Meer der Vergangenheit. Und die Zukunft bewegt sich ständig vor uns her und wird sofort, sobald nur eine Millisekunde verstrichen ist, von der Vergangenheit verschluckt. Es ist nur unser subjektives Empfinden, das uns eine Gegenwart vorgaukelt, wenn wir etwa von „heute“ reden und damit den jetzigen Tag bezeichnen. Der Begriff der Gegenwart erleichtert uns das Agieren in unserer Welt und dient der Verständigung mit anderen. Die Vergangenheit unterscheidet sich von der Zukunft durch den Faktor der Nicht-Veränderbarkeit. Nichts, was geschehen ist, kann rückwirkend ungeschehen gemacht werden. Dagegen ist die Zukunft wie ein noch die unbeschriebenen Seiten eines Buches, das allmählich mit dem gefüllt wird, was geschehen ist. Die Macht der Vergangenheit wird uns dann bewusst, wenn wir durch die Taten der Vergangenheit in der subjektiv empfundenen Gegenwart auf diese Mächtigkeit aufmerksam gemacht werden. So genannte Fehlentscheidungen der Vergangenheit holen uns irgendwann ein. Die Zukunft hingegen ist das, was uns als Konsequenz unseres Handelns in der Vergangenheit begegnen wird. Es sind die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintretenden Ereignisse als Folge unserer Handlungen in der Vergangenheit. Eine begangene Straftat bedingt nicht 100 %-ig eine Gefängnisstrafe, aber die Wahrscheinlichkeit eines Gefängnisaufenthaltes wird einfach erhöht. Hinzukommen müssen noch das „Ertapptwerden“, die Beweisbarkeit der Straftat und die Gnädigkeit/Ungnädigkeit des Richters. Die Gewissheit, dass wir eine Straftat begangen haben, ist nicht aufhebbar, sie erscheint uns immer wieder vor unserem geistigen Auge, wir können sie vielleicht in unserem Gedächtnis versuchen zu löschen, aber nicht in der Wirklichkeit, die bereits geschehen ist.
| Vergangenheit |
Zukunft |
| nicht veränderbar |
veränderbar |
| Zukunft bestimmend |
Folgen der Entscheidungen |
| Gewissheit, Bestimmtheit |
Ungewissheit, Wahrscheinlichkeiten |
Eine Welt, in der wir zu spät erkennen, einen Fehler begangen zu haben, in der dann dieser Fehler wie mit einem Radiergummi entfernt werden kann, gibt es leider nicht. Es gibt so etwas wie eine „Entscheidungstetermination“, d. h. dass Entscheidungen der Vergangenheit die Zukunft ein Stück weit vorherbestimmen. Mit jeder Entscheidung, die auf einer vorausgehenden folgt, wird der Spielraum für künftige Entscheidungen eingeengt. Kriminelle Karrieren beginnen oft mit kleinen „Mutproben“, die von der Peer-Group einer Jugendbande verstärkt werden und die weitere kleine Delikte nach sich ziehen, sofern nicht der Mut aufgebracht wird, diese Gruppe zu verlassen. Irgendwann erkennt jemand, dass er noch von dem in Bewegung gesetzten Zug hätte abspringen können, aber irgendwann es für den Absprung zu spät ist.
· „E-Tage“: Ich kann mich noch recht gut an den Film „Hinter dem Horizont“ [14] erinnern, in dem der Ehemann Chris Nielsen (Robin Williams) immer von so genannten „E-Tagen“ gesprochen hatte, wenn eine wichtige Entscheidungen anstanden. Wir kennen alle diese Tage, die manchmal voraussehbar sind oder aber unverhofft auf uns zukommen, an denen wir Entscheidungen treffen müssen. Hier gilt oft der analog anzuwendende Satz von Watzlawik (1921 -2007) von der Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren [15] , in dem auch gesagt werden muss, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Auch hier spielt der Zeitpunkt der Entscheidung eine Rolle, denn wenn wir uns zu früh entscheiden, bevor wir alle möglichen Aspekte erfasst haben, kann es zu Fehlentscheidungen kommen. Andererseits können wir auch zu lange warten und die „Gunst der Stunde“ ist vorbei, in der eine Entscheidung sinnvollerweise hätte getroffen werden müssen. Es muss, wenn solche „E-Tage“ absehbar auf uns zukommen, vor zwei Fehlertypen unterschieden werden: Aktionismus und Zauderhaftigkeit. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass eine Art Aktionismus ausgebrochen war und Politiker sich – auch durch die aufbauschende Berichterstattung der Medien („nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht“) angestachelt – quasi genötigt sahen, Ad-hoc-Entscheidungen zu fällen, die nicht ausgereift waren. Je mehr sie in diesem Aktionismus-Modus gefangen waren, desto schneller, übereilter und unüberlegter und damit auch schädlicher wurden die Entscheidungen. Auf der anderen Seite gibt es das Zaudern, das zu lange Warten auf Entscheidungen, die zum Verhängnis wird. Einen von Selbstunsicherheit und Selbstzweifel geplagten Kommandanten eines Minensuchzerstörers handelt der Film „Die Caine war ihr Schicksal“ [16] , in dem der Kapitän Francis Queeg (Humphrey Bogart) in einer entscheidenden Phase (Konfrontation mit einem Taifun) nicht zu Entscheidungen fähig ist, die das Schiff aus der gefährlichen Zone herausgebrach hätte. Sein Beharren auf unsinnigen, alten Befehlen, durch die er seine angegriffene Autorität kaschieren wollte, brachte alle in Bedrängnis, was letztendlich zur Meuterei und seine Absetzung führte. Ähnlich erging es dem Bundeskanzler. Olaf Scholz wurde ein zu langes Zaudern in der jetzigen Ukraine-Krise vorgehalten [17] , was dazu führte, dass er in seinen Entscheidungen oft der allgemeinen Entwicklung hinterherhinkte, statt mutig selbst Entscheidungen zu fällen. Er, der wie ein Bedrängter agierte, wirkte nicht wie ein selbstbewusst auftretender Kommandant, sondern eher wie ein rückgratloser Mitläufer, der nur dem allgemeinen Trend hinterher eilte. Von Selbstbewusstsein zeugte keine seiner Entscheidungen. Das Zaudern aus Schwäche führt zu Fehlentscheidungen, weil dann nur durch Druck von außen nachgegeben wird, statt zu eigenständigen Entschlüssen zu gelangen.
Den richtigen Zeitpunkt abzupassen ist wahre Lebenskunst. Sie wird dann am ehesten gelingen, wenn die Lebensweisheit als Lehrmeister Pate steht und dazu verhilft, die richtigen Entscheidungen zu den dem richtigem Zeitpunkt zu treffen – leider zu unserem Leidwesen, werden die Chancen mit zunehmenden Alter immer geringer, hiervon Gebrauch zu machen. Entweder man hatte in der Vergangenheit diese Kunst bereits beherrscht oder es bleibt nur die Hoffnung auf die nächste Inkarnation.
© beim Verfasser
[1] Hinweise hierfür gibt das Phänomen der Präkognition, die auch während der Nahtoderfahrung erlebt wird, indem jemand erfährt, wie sein späteres Leben verlaufen wird; Günther Birkenstock: Nahtoderfahrungen – ein Indiz für ein Leben nach dem Tod? https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite.
[2] In der US-Serie „Mein Vater ist ein Außerirdischer“ konnte die Hauptdarstellerin, die zur Hälfte (Vater) von einem Außerirdischen abstammte, die Zeit anhalten, indem sie die Zeigefinger gegeneinander stellte; https://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Vater_ist_ein_Au%C3%9Ferirdischer
[4] Albert Einstein hat diese Vorstellung in seiner Relativitätstheorie eingearbeitet.
[5] Auf Goethe zurückgehend: Laßt mich das Unglück noch vierzig Jahre genießen. Der lacht wohl, der zuletzt lacht " https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=wer+zuletzt+lacht%2C+lacht+am+besten&bool=relevanz&sp0=rart_ou
[8] Der Begriff „Selbstmord“ ist eigentlich unzutreffend, denn der juristische Begriff des Mordes bezieht sich immer auf eine Tötung aus „niederen Beweggründen“ (genauer nach § 211 StGB. Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken; https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__211.html ). Aber die anderen Bezeichnungen wie „Freitod“, „Selbsttötung“, „Suizid“ – wenn man kein passendes deutsches Wort weiß, flüchten einige gern in die Fachbezeichnungen – sind auch nicht besser.
[10] Günther Birkenstock: Nahtoderfahrung – ein Indiz für ein Leben nach dem Tod? https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite
[15] „Man kann nicht nicht kommunizieren“; https://de.wikiquote.org/wiki/Paul_Watzlawick
[17] https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100133786/schluss-mit-dem-zaudern-herr-bundeskanzler-.html ; https://www.youtube.com/watch?v=fqZr1lYVTnM Die Mainstream-Medien spielen hierbei eine nicht nachvollziehbare Kriegstreiberrolle.