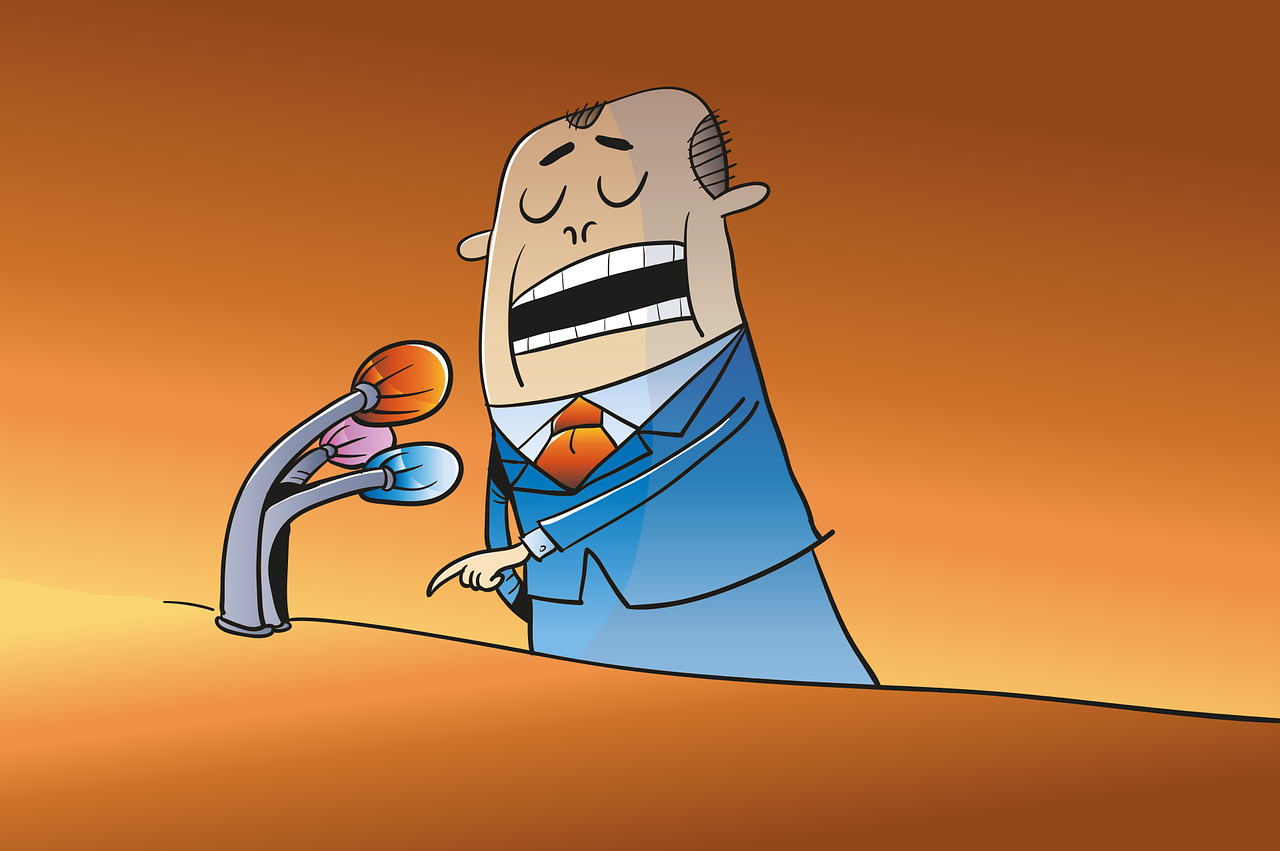Führt der Atheismus zu einem moralischen Niedergang?
Gründe für eine "sittliche Verwahrlosung" - ohne Gott bleiben wir charakterschwache Wesen

Wir erleben einen kontinuierlichen Niedergang der „westlichen Welt“ im Hinblick auf Moral und eine zunehmende atheistischer Gesinnung, die anscheinend Hand in Hand gehen. Gibt es da einen Zusammenhang, d. h., dass sich mit zunehmender Gottlosigkeit auch der moralische Verfall einer Gesellschaft beschleunigt? Oder ist es eher umgekehrt, dass eine Abkehr von klassischen Vorstellungen über Gott als einen strafenden Richter den Mensch frei gemacht hat?
Gott als Realität oder nur Metapher: Wenn wir in der Geschichte der Menschheit weit zurückgehen, dann kann erkannt werden, dass in früheren Zeiten die meisten Menschen einen unmittelbareren Bezug zu Gott hatten. Dieser drückte sich darin aus, dass sie der Überzeugung waren, dass Gott allgegenwärtig ist und er nicht nur fern unserer Welt irgendwo in einen imaginären Himmel wohnt. Diese Direktheit war Ausdruck eines fast kindlichen Glaubens, der sich speiste aus Vorstellungen antiker Kulturen, die eigentlich immer ein ambivalentes Verhältnis zwischen Gott und den Menschen beschrieben. Diese Ambivalenz bestand darin, dass Gott sowohl geliebt als auch gefürchtet wurde. Das Gefühl der Liebe speiste sich aus einer Vorstellung, dass Gott wie ein treusorgender Vater oder wie eine behütende Mutter stets selbst oder durch seine Gefolgschaft (Engel, Mächte, Gewalten) seine oder ihre schützende Hand über alle hielt. Die Furcht wurde geboren aus der Vorstellung, dass die Gottheit aber auch richten, strafen und sogar vernichten kann, wenn die Menschen sich gegen ihn stellen. Gott hatte also ein Janusgesicht [1] , das uns in seiner Doppelbödigkeit sowohl positive Gefühle als auch negative Emotionen hervorrief. Mit der Aufklärung wurde Gott von seinem hohen Sockel gestoßen und der Mensch wollte sich nicht mehr unter die Herrschaft eines oder mehrerer Götter stellen, sondern sich selbst befreien aus der als Unterjochung empfundenen Abhängigkeit. Spätestens jetzt mutierte Gott zu einer Metapher, die verwendet wurde, um über das Unaussprechliche zu philosophieren, um ihn nur noch als eine Symbolfigur zu sehen, die für das Gute stand, das anzustreben der Mensch sich aufgefordert sah. Aber was ist das Gute, was war das Gegenteil hiervon? Kann der Mensch überhaupt dies selbst definieren? Kann er sich selbst gewissermaßen zum Gott erklären und sich anmaßen, von anscheinend gottgegebenen Maßstäben Abstand zu nehmen? Ist die Frage nach der Moral dann nur noch eine Frage des Konsenses? Ist die moralische Gesinnung, wenn sie nicht gottgegeben ist, nur noch von menschlichen Definitionen abhängig? Wie sieht also die gegenwärtige Welt aus, die sich auf eine abendländliche Kultur beruft, wonach wir zwar unserer Wuzeln im christlichen Glauben haben, aber trotzdem uns als befreit erklären von einem bevormundenden Gott?
Sittliche Verwahrlosung: Unsere gegenwärtige westliche Welt erscheint immer stärker einem sittlichen Verfall entgegenzugehen, sich gewissermaßen aufzulösen, weil die bindenden Kräfte der traditionellen Bilder eines allmächtigen Gottes schwinden und sich dem nichts Adäquates entgegenstellt. In der klassischen Fürsorge hatte man den Begriff der Verwahrlosung [2] gebraucht, um einen Zustand von Menschen zu beschreiben, die nicht mehr in der Lage waren, ihre private kleine Welt sorgfältig zu planen, zu ordnen und in einem angemessenen Rahmen zu halten. Sie wurden notfalls in „Anstalten“ untergebracht, wenn diese Verwahrlosung auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen war und ihnen die Kinder weggenommen, wenn dadurch das Kindeswohl gefährdet war. Im übertragenen Sinne stellt sich die Frage, ob eine Gesellschaft und dann auch ihre Mitglieder in eine Art „sittliche Verwahrlosung“ geraten können. Es stellt sich dabei die Frage, ob diese mit der zunehmenden Gottlosigkeit einhergeht. Gehen wir also dieser „sittlichen Verwahrlosung“ auf die Spur:
· Moralische Beliebigkeit : Die moralischen Maßstäbe unseres Verhaltens scheinen immer mehr zu verschwinden, sodass die festen Größen nicht mehr angenommen und statt dessen nach Nützlichkeits- und Notwendigkeitsüberlegungen je nach Situation, Stimmung und subjektiver Befindlichkeit die moralischen Grundsätze festgelegt werden. Die letztgenannte Variante moralischer Orientierung wird auch als Utilitarismus bezeichnet. Dieser Sichtweise steht die moralische Orientierung entgegen, die von quasi unverrückbaren Prinzipien ausgeht: Deontologie [3]. Einer der bekanntesten Vertreter dieser moralischen Orientierung war Immanuel Kant, der mit seiner „Pflichtethik“ postulierte, dass jeder sich einer nicht von „Neigungen“ abhängigen Moral leiten lassen sollte. Eine seiner bekanntesten Postulate ist der des kategorischen Imperativs , der darin bestand, dass er aus der Warte einer von der eigenen Person unabhängig bestehenden Verpflichtung gegenüber einer a-personalen Moral gesehen wurde. Den daraus abgeleiteten Maximen sollte sich jeder verpflichtet sehen, weil nur dann sie als allgemeingültig angesehen werden könnten, wenn sie eben nicht von subjektiven Befindlichkeiten und Neigungen sowie äußeren Bedingungen abhängig sind [4]. Dem kategorischen Imperativ , so wie in Kant verstanden hat, setzen die Utilitaristen ihre den von Situationen, Neigungen und eigenen Interessen geleiteten Moralanspruch entgegen, der es dann auch erlaubt, z. B. zu lügen (wenn dies nützlich ist), zu stehlen (wenn es einer „guten Sache“ dient) oder auch jemand zu verletzen oder gar zu töten (etwa in einem „gerechten Krieg“), wenn dies die Situation erfordert oder bestimmten Interessen dienlich ist. Diese moralische Beliebigkeit drückt sich auf vielfältige Weise in unserem Alltagsverhalten aus, aber auch im größeren Rahmen in den Handlungen von Politikern, die sich anmaßen, ihre subjektiven Maßstäbe so definieren, dass sie ihren eigenen Interessen dienen. Die Wahrheit gilt dann nicht mehr als allgemein gültiger Maßstab, sondern das Lügen gehört dann zum täglichen politischen Geschäft, wenn es einer „guten Sache“ dient [5]. Ist die moralische Beliebigkeit ein Ausfluss eines zunehmenden Atheismus? Wenn wir vom Monotheismus ausgehen, also der Vorstellung eines einzigen Gottes, dann können wir erkennen, dass Gott relativ klare Vorstellungen hatte von dem, wie sich Menschen verhalten sollten. Die Zehn Gebote, wie sie uns via Bibel übermittelt werden, spiegeln diese klaren Vorstellungen wieder und zeigen, dass Gott sehr wohl einen klaren deontologischen Ansatz hatte, indem er einfach sagte: „Du sollst nicht falsches Zeugnis reden“, also „du sollst nicht lügen“ oder „du sollst nicht ehebrechen“ [6]. Es gibt keine Nützlichkeitsüberlegungen in der Weise, dass etwa der Ehebruch unter gewissen Umständen erlaubt sein könnte. Jesus hatte dies auch nochmals in der Weise verschärft, dass bereits der Gedanke an den Ehebruch – indem ein Mann eine verheiratete Frau ansieht, um sie zu begehren – bereits zu verurteilen sei (Matthäus 5,28 [7] ). Der utilitaristische Ansatz könnte hierzu lauten: Wenn Ehe-Partner den Ehebruch als eine einverständliche Kann-Regel einführen, dann ist das ok, d.h. dass dann der Ehebruch nicht mehr als unumstößlich gelten würde, sondern unter der Bedingung einer einverständlichen Einigung möglich sein soll. Weil die Bindung der Menschen an feste moralische Gesetze schwindet, weil sie nicht mehr an einen Gott glauben, der ihnen die eindeutige Richtlinie an die Hand gibt, dann fördert dies eindeutig den moralischen Verfall. Ist also der Ehebruch, wenn er einverständlich geschieht, dann nicht so schlimm? Es gibt ja inzwischen Internetportale, auf denen man sich für einen Ehebruch geeignete Partner suchen kann [8]. Hat sich Gott vielleicht geirrt, als er dieses strenge Verbot des Ehebruches erfand? Hier hilft die Analogie mit dem Sabbat-Gebot, von dem Jesus ja sagt, dass es für den Menschen da sei und nicht der Mensch für den Sabbat (Markus 2,27 [9] ). Mit diesem Gebot wollte vielleicht Gott den Weg zum Heiligen erleichtern, indem er dem Menschen auftrug, wenigstens an einem Tag in der Woche inne zu halten und sich bewusst zu werden, dass das Leben nicht nur aus dem täglichen Kampf ums Überleben bestehen sollte, sondern auch dazu da ist, sich der höheren Dimensionen des Daseins bewusst zu werden. Genauso könnte es sich mit dem Verbot des Ehebruch verhalten, denn dieses Gebot hat er wohlweislich geschaffen, um das Fundament der Ehe, nämlich das Vertrauen untereinander, zu schützen, denn geht dieses verloren, gerät die Ehe als ein unumstößliches Band zwischen Mann und Frau in Gefahr. Die Gefahr besteht darin, dass das Heilige in der Ehe zerstört wird, das in dem eindeutigen wechselseitigen Versprechen der Treue besteht. Es spiegelt darin analog auch das Verhältnis wieder, das zwischen Gott und dem Menschen bestehen sollte, nämlich auch hier keine fremden Götter (Götzen) zu dulden (1. Gebot). Die 10 Gebote oder das, was Jesus in der Bergpredigt mitgeteilt hat, das mag das Beispiel des Ehebruch-Verbotes deutlich machen, sind nicht verhandelbare Grundsätze, die ihren tiefen Sinn in der Verlässlichkeit der Beziehungen der Menschen untereinander oder zu Gott zum Thema haben und damit eine Fundierung darstellen, die Stabilität verleihen.
· Selbstvergottung : Gott als eine Autorität zu akzeptieren, die aufgrund seiner Weisheit den Menschen weit voraus ist, ist eine Einsicht, die sich dem aufdrängt, der an einen allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Gott glaubt. Der so glaubende Mensch akzeptiert den Absolutheitsanspruch, der sich daraus ergibt und ordnet sich dem unter. Nicht so der Gottlose, denn er setzt sich selbst an dessen Stelle und glaubt, die Gesetze nach seinen eigenen Maßstäben neu definieren zu können. Dies führt zu einer Selbstvergottung, die dem ähnelt, was mit dem Anspruch Luzifers korrespondiert, sich an die Stelle Gottes zu setzen und eine andere, aus seiner Sicht „bessere Welt“ zu schaffen. Dies führte unweigerlich zum „Engelssturz“ und zu einer Spaltung der Welt, die einst einmal heil war. Seit diesem himmlischen Vorfall versucht der einst abgefallene Engel Luzifer, nun Satan, mit seinem Heer an treuen Anhängern (ein Drittel der Engel sollen es gewesen sein [10] ), diese Spaltung zu vertiefen. Die Rebellion gegen Gott ist eine Auflehnung gegen seine von ihm geschaffene Ordnung. Menschen, die sich dem anschließen, folgen diesem Beispiel und wollen selbst Gott spielen. Die „Ampelregierung“ versucht dies im Augenblick in der Weise zu vollziehen, indem sie ein Gesetzesvorhaben umsetzen will, nachdem jeder sein Geschlecht selbst wählen können soll. Dieses als „Selbstbestimmungsgesetz“ [11] bezeichnende Vorhaben ein zutiefst atheistisches Machwerk, weil es die göttliche Ordnung negiert, wonach der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde (1. Mose 1,27 [12] ) und somit es keine Selbstbestimmung gibt, wonach jemand es frei ist zu entscheiden, ob er ein Mann oder eine Frau ist. So zu sein wie Gott ist die erste Versuchung der Schlange (Satan) im Garten Eden, die die Menschen zur Abkehr von Gott verleitete (1. Mose 1,3 [13] ). Erich Fromm verwendete zu diesem Thema ein ganzes Buch, in dem er versuchte, den Anspruch der Menschen, verleitet durch Satan, sich aus der autoritären Herrschaft Gottes zu befreien, zu analysieren [14]. Er saß den autoritären Ansprüchen der Kirchen auf, die diesen Bibelvers sehr wohl verstanden als eine Möglichkeit, in die Stellvertretung Gottes auf Erden zu schlüpfen, um ihren Herrschaftsanspruch dadurch zu untermauern. Zu Recht hat er da seine religionskritische Analyse angesetzt und für eine Befreiung von dieser Art der Herrschaft plädiert. Aber ist der Weg in die Selbstvergottung, wie sie von Satan versprochen wurde, wirklich eine Befreiung? Wer diesen Weg gehen will, verkennt, dass dieser geradewegs in eine Art neuer Diktatur führen kann, weil nunmehr die Menschen anfangen, ihre Vorstellungen gegen andere autoritär durchzusetzen. Erich Fromm war sehr von dem „atheistischen“ Weltbild des Buddhismus angetan, der überhaupt keine Autorität seitens Gottes über den Menschen noch der von Menschen über andere verspricht [15]. Diese Art der „Selbsterlösung“ durch eigene Bemühungen wäre sicher erstrebenswert, wohlweislich ist es aber so, dass die Schwäche des Menschen, sich selbst aus eigener Kraft zu erlösen, darin besteht, den mannigfachen Versuchungen zu erliegen. Diese Versuchungen bestehen in den mannigfachen Fallen, die auf dem schwachen Menschen lauern, angefangen von der Falle des Müßiggangs, der Maßlosigkeit in jeglicher Hinsicht, bis hin zu dem der Herrschaft über andere. Die Märchen haben diese Fallen stets gut beschrieben, wie z. B. in dem Märchen vom „Fischer und seine Frau“ (aus dem Plattdeutschen „Vom Fischer und sinner Fru“ von Gebrüder Grimm aufgegriffen [16] ), in dem der vom Fischer gerettete Butt, die bis in Unermessliche gehenden Ansprüche der Frau befriedigen sollte und diese zuletzt an dem Wunsch scheiterte, wie Gott sein zu wollen. Wie sehr dieser Wunsch nach Befreiung von einer Gottesherrschaft verständlich ist, so geht dieser doch an dem vorbei, was Jesus den Jüngern und damit auch den Menschen aufgetragen hatte, nämlich einander zu dienen und nicht zu herrschen, weil jede Form der Herrschaft aus seine Sicht von Übel ist [17]. Gott, folgt man den Intentionen seiner Ausführungen, geht es nicht um die Durchsetzung seiner Vorstellungen gegen den Widerstand der Menschen, sondern er will wie ein guter Pädagoge den Menschen helfen, sich aus Fängen der satanischen Versprechungen zu befreien, die letztendlich ins Verderben führen, weil sie sie auf Lügen basieren.
· Götzendienst : Wenn die Selbstvergottung nicht recht funktionieren will, erfinden Menschen Götzen. Die Ablehnung des Götzendienstes geht auf das erste Gebot zurück, wonach Gott den Juden aufgetragen hatte, keinen anderen Göttern zu dienen (2. Mose 20,3 [18] ). Während bei der Selbstvergottung die Menschen sich auf den göttliche Sockel stellen, lassen sie sich als Ersatz für die Anerkennung eines allmächtigen Gottes dazu verleiten, Ersatzgötter zu erfinden, die diese Lücke ausfüllen sollen. Es liegt anscheinend in der Natur des Menschen begründet, sich entweder selbst zu Gott zu erklären oder ersatzweise hierfür, wenn dies nicht recht funktionieren will, Ideale zu konstruieren, die eine externe Bezugsquelle für ihr Verhalten darstellen. Diese Gefahr bestand zu allen Zeiten, in denen Menschen den Glauben an einen Gott verloren hatten und sich anschickten, hierfür Ersatz zu finden. Der Götzendienst hat mehrere Aspekte:
· Ideologien : Unter einer Ideologie kann eine als wahr erklärte Scheinwahrheit verstanden werden, die jeder Realitätsprüfung trotzt. Es wird etwas für wahr gehalten, was aber bei näherer Betrachtung eben nicht wahr ist. Dabei werden durch Wahrnehmungsfilter alle die eigenen Vorstellungen widersprechenden Informationen ausgeblendet. Je abstrakter die für wahr gehaltenen Scheingebilde sind, desto mehr widerstehen sie einer kritischen Prüfung. Ein Beispiel hierfür ist der so genannte Klimawandel, der nur auf einen vom Menschen beeinflussten Effekt durch die Produktion des Treibhausgases Kohlendioxid verursacht werden soll. Alle natürlichen Einflussfaktoren werden bei dieser Ideologie ausgeklammert und Abweichungen des Klimamodells – wenn es eben nicht dauernd überall wärmer wird – negiert.
· Idole : Neben abstrakten Begriffen können auch Menschen zu „Halbgöttern“ hoch stilisiert werden, die sich verehren lassen, so als ob sie gottgleich wären. Gerade in der Unterhaltungsbranche gedeihen solche Idole prächtig, die sich von ihrer Fangemeinde wie Götter verehren lassen. Aber auch Politiker können der Versuchung nicht widerstehen, sich als Idole feiern zu lassen, wobei die Medien als Helfershelfer fungieren.
· Diesseitsorientierung : Götzen haben keine überirdische Funktion. Sie dienen allein mit ihrem scheinbaren Heiligenschein nur als Figuren einer „schönen, neuen Welt“ [19] , die keine Jenseitserwartung kennt, sondern bei der sich Menschen nur in dem Glauben wähnen, dass die diesseitige Welt die einzig gültige ist, in der alles erreicht werden soll, was in dem relativ kurzen Leben erreicht werden kann.
· Heuchelei: Die Heuchelei kann als ein Mittel angesehen werden, eine Scheinmoralität vorzutäuschen, die einer kritischen Prüfung nicht standhalten kann. Die Heuchelei äußert sich entweder in der Weise, dass etwas vorgetäuscht wird (z. B. man sei sehr sozial und mitfühlend), was aber gar nicht vorhanden ist (man denkt bei sozialen Aktivitäten eigentlich nur an die dabei entstehende positive Reputation für die eigene Person) oder es wird von anderen etwas verlangt, was man selbst nicht bereit ist zu tun („Wasser predigen und Wein trinken“ [20] ). Sie hat zwei Aspekte:
· Innerer Aspekt (sich gut fühlen ohne gut zu sein): Menschen, die sich heuchlerisch verhalten, glauben von sich, dass sie wirklich gut sind. Sie unterliegen einer Selbstsuggestion, durch die sich als gute Menschen anfühlen. Sich täuschen sich gewissermaßen selbst, indem sie etwa durch „fromme Handlungen“ glauben, auch tatsächlich fromm zu sein. Das „gute Gefühl“ ist für sie sehr wichtig, weil sie damit die Autosuggestion perfektionieren, indem sie alle Selbstzweifel am eigenen Verhalten („ist das wirklich richtig, was ich hier tue?“) ignorieren.
· Äußerer Aspekt (gut erscheinen ohne gut zu sein): Der „Gutmensch“ [21] kann als Prototyp des nach außen gut erscheinenden Menschen angesehen werden, der es geschickt versteht, anderen vorzugaukeln, moralisch gesehen gut zu erscheinen, ohne es wirklich zu sein. Sein Engagement reicht nur so weit, dass ein positiver Eindruck bei dem Betrachter entsteht, der aber in Wirklichkeit nicht auf echten Tatsachen beruht. Er würde niemals aus seiner Komfortzone herausgehen und stets auf seine eigene Sicherheit und sein Wohlergehen bedacht sein. Das Beispiel der Seenotretter [22] kann hierfür bezeichnend sein. Die Seenotretter verkaufen sich gern als Helden, die Menschen davor bewahren, im Mittelmeer zu ertrinken. Sie verstehen es geschickt, sich so darzustellen, als ob sie nur darauf aus wären, anderen das Leben zu retten, blenden dabei aber in geschickter Weise sowohl die vorausgegangen Ursachen als auch die Folgen ihres Handelns aus. Wenn sie Menschen vor dem Ertrinken retten und die von Schleppern in klapprigen, nicht seetüchtigen Booten transportierten Migranten übernehmen, dann belohnen sie die Schleuser indirekt mit ihren Rettungen und sorgen dafür, dass diese in ihrem Verhalten bestärkt werden und ihnen damit ein auskömmliches Leben ermöglicht wird, denn diese lassen sich von den so genannten Flüchtlingen für ihre Dienste gut bezahlen. Dass sie dabei nicht die wirklich Schwachen, sondern die durchsetzungsfähigen und rücksichtslosen, nur an den eigenen Vorteil denkenden Migranten unterstützen, kommt ihnen nicht in den Sinn. Die Folgen der Seenotrettung werden von den meistens in so genannten NGO´s operierenden Fluchthelfern den Ländern aufgebürdet, denen sie die Geretteten einfach übergeben [23]. Sie übernehmen nicht die Folgekosten der Versorgung dieser Menschen, sie bedenken nicht die Folgen einer wachsenden Entfremdung im eigenen Land durch den Zuzug kulturferner Menschen und negieren, dass auch gewaltbereite und offen kriminell agierende Personen eingeschleppt werden. Die von den „Scheinchristen“ durch das Gebot der christlichen Nächstenliebe begründete Notwendigkeit einer moralischen Pflicht zur Seenotrettung kann ganz leicht durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ad absurdum geführt werden. Jesus hatte nämlich in diesem Beispiel klar aufgezeigt, dass der Samariter den unter die Räuber gekommenen Menschen nicht einfach in der Herberge abgeben hat, sondern auch dafür bezahlt und weitere Zahlungen in Aussicht gestellt hat (Matthäus 10, 35-37). Hiervon sind aber die unter christlicher Flagge agierenden Seenotretter weit entfernt, weil diese für die weiteren Folgekosten eben nicht aufkommen wollen.
· Keine Schuld: Die Begriffe Sünde, Schuld, Reue und Sühne sind nicht mehr gefragt. Sie spiegeln anscheinend ein antiquiertes Weltbild wieder, das der moderne Mensch gerne überwinden möchte. Viel lieber wird von Ursachen gesprochen, von Umständen, die zu Fehlverhalten führen und auch sehr schnell Entschuldigungen (psychische Erkrankung, schlechte Kindheit, soziale Umstände, Sachzwänge) gefunden, die den Gedanken einer Schuld eliminieren sollen. Die Sünde als die Wurzel allen Übels, wie dies noch in der Bibel nachzulesen ist, wird gerne überlesen und, wenn man sich in „christlichen Kreisen“ bewegt, sehr schnell von Gottes Barmherzigkeit gesprochen, auf die jeder hoffen könne. Dies führt zu einer modernen Verantwortungslosigkeit, in die diejenigen sich gerne zurückziehen, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird [24]. Schuld zu haben ist aber ein essentieller Bestandteil der auf Gott zurückgehenden Moralvorstellungen, was Jesus mehrfach betont. In der Geschichte von der Frau, die wegen Ehebruchs gesteinigt werden sollte, entkräftete er die Anschuldiger mit dem einfachen Satz: „Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ (Johannes 8,7 [25] ). Mit der Sünde – Übertretung eines göttlichen Gebotes – kommt die Schuld auf, die durch den Fehltritt entstanden ist, was folglich zur Einsicht, Reue und Sühnung führen sollte – so die Reihenfolge [26]. Heutzutage werden gnadenlos im übertragenen Sinne Steine auf andere geworfen, weil sie in der Weise als schuldig angesehen werden, nicht die Mehrheitsmeinung zu vertreten. Von Sünde wird schon lange nicht mehr gesprochen, seit die damit verbundenen Vorstellungen nicht mehr als zeitgemäß angesehen werden. Wenn aber Schuld nicht mehr eingestanden wird und mächtige Politiker sich hinter die starken Mauern einer schwachen Staatsanwaltschaft zurückziehen können, weil diese sich nicht trauen, gegen Politiker wenigstens Ermittlungsverfahren einzuleiten [27] , geht es mit Moral bergab, denn der normale Bürger fragt sich berechtigterweise, warum er für vergleichbare Vergehen sofort mit Konsequenzen rechnen muss, während Politiker ungeschoren davonkommen.
· Korruption: Mit Korruption assoziiert jeder den Gedanken an einen Antragsteller bei einer Baubehörde, der für eine beschleunigte Bearbeitung seines Antrages gleich einen Briefumschlag mit einigen Geldscheinen über den Tisch schiebt. Dies ist nur ein winziger Teil der Korruption, die in Deutschland und auch weltweit geschieht. Im Wesentlichen besteht Korruption aus zwei Teilen: Erstens handelt jemand gegen seine eigenen Überzeugungen (er stimmt z. B. als Abgeordneter einem Gesetz zu, dem er nicht zustimmen würde, wenn er allein zu entscheiden hätte). Zweitens lässt sich jemand darauf ein, hierfür Vorteile (Beförderung, höhere Vergütung...) entgegenzunehmen oder Nachteile (Entlassung, Existenz- oder Ansehensverlust durch Nicht-mit-Machen) zu vermeiden. Das Zustandekommen und die Wirkungsweise der Korruption hat der Virologe Dr. Wolfgang Wodarg in einem Vortrag aufzugdröseln versucht. Er definiert Korruption als den „Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Nutzen und Vorteil“ [28]. Er sieht einen zunehmenden Missbrauch der Macht von denen, die diese Macht im Rahmen einer demokratischen Verfassung vom Volk erhalten, sich aber diesem Vertrauensvorschuss als unwürdig erwiesen haben. Dieser Missbrauch besteht in der eigenen Vorteilsan(mit)nahme durch Mandatsträger, Minister und unterordnete Beamte und zum anderen durch den Einfluss derer, die als „Lobbyisten“ bezeichnet werden und die durch verschiedene Methoden auf die Entscheidungen von Politikern Einfluss nehmen, wobei es auch Überschneidungen zwischen Entscheidungsträgern und Lobbyisten gibt, weil diese Funktionen in einer Person konzentriert sind. Dabei fließen auch Geld und andere Vergünstigungen, die die Entscheidungen der Politiker „erleichtern“ sollen. Hierbei findet die Korruption nicht nur von einzelnen statt, sondern es ist ein Netzwerk von „institutionalisierter Korruption“ entstanden, sodass gar keine Regelverletzungen mehr passieren, sondern, weil die Strukturen so geschaffen wurden, der Einzelne regelkonform korrumpiert wird [29]. Gerade in den Corona-Zeiten wurde die Korruption offensichtlich, weil die kritischen Stimmen zu den staatlichen Maßnahmen nicht hinterfragt werden durften und diejenigen ihre Vorteile hatten, die dabei im Sinne der Regierung mitgemacht haben [30]. Korruption gab es schon zu Jesus Zeiten, denn als Palästina von den Römern besetzt war, waren es die Priester, die in dem Sinne korrupt waren, dass sie für ein bequemes Leben mit den Besetzern kooperierten. Da Jesus dies aufgedeckt und offen angesprochen hatte, waren es diese Priester, die dafür sorgten, dass Jesus verhaftet und den römischen Machthabern (in der Person des Pontius Pilatus) überantwortet wurde.
Gottesferne und sittliche Verwahrlosung: Geht der Atheismus einher mit einer sittlichen Verwahrlosung? Die Beispiele zeigen deutlich, dass der Mensch anfällig ist für das, was wir das Böse nennen, wenn er glaubt, hierfür nicht bestraft zu werden. Solange Menschen noch das Jüngste Gericht fürchteten, konnte dieser besonderen Art der Verwahrlosung Einhalt geboten werden. Als aber dieser Glaube mehr und mehr dahinschwand, lebten auch immer mehr Menschen nach dem Motto: Es ist alles erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen [31]. Die sittliche Verwahrlosung beginnt eben mit kleinen Sauereien (kleine Schummeleien bei der Steuerklärung, mal etwas „aus Versehen“ im Hotel „mitgehen lassen“) und endet in großen Sauereien (Massentötungen durch „gerechte Kriege“), bei denen Menschenleben oder das Leben von Tieren und Pflanzen keine Rolle mehr spielen.
Wir können leider nicht auf eine menschliche Gerechtigkeit hoffen. Diese ist in der langen Geschichte der Menschheit immer wieder gescheitert. Ohne die göttliche Hilfe werden wir es nie schaffen können, eine solche Welt zu kreieren, weil wir zu charakterschwach sind. Dies zuzugeben fällt vor allem denjenigen schwer, die meinen, die Gerechtigkeit und Anständigkeit in Person zu sein.
© beim Verfasser
[4] Das ist der von Kant postulierte Unterschied zwischen dem „kategorischen Imperativ“ und dem hypothetischen Imperativ“: https://studyflix.de/allgemeinwissen/kategorischer-imperativ-kant-4464
[5] Der Satz „was kümmert mich mein Geschwätz von gestern“, der Konrad Adenauer zugeschrieben wird, beschreibt diese Art der sittlichen Beliebigkeit: https://www.konrad-adenauer.de/zitate/
[6] Siehe hierzu auch den Artikel „Sind die 10 Gebote auch heute noch gültig?“ https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite
[11] https://www.bmj.de/DE/themen/gesellschaft_familie/queeres_leben/selbstbestimmung/selbstbestimmung_node.html
[14] Erich Fromm: Ihr werdet sein wie Gott; https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1046548784
[15] https://www.deutschlandfunk.de/erich-fromm-und-die-religionen-ihr-werdet-sein-wie-gott-100.html
[19] Ausdruck von Aldous Huxley nach seinem Roman „Schöne, neue Welt“; https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/EXO.20/2.-Mose-20
[20] Ausspruch im Gedicht von Henrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. https://de.wiktionary.org/wiki/Wasser_predigen_und_Wein_trinken
[21] Mehr hierzu siehe: https://www.guentherbirkenstock.de/blog-search?searchTerm=gutmensch
[22] Mehr hierzu siehe: https://www.guentherbirkenstock.de/warum-ich-gegen-die-seenotrettung-bin
[23] Es ist bezeichnend, dass Deutschland (Beschluss des Haushaltsausschusses nach Vorschlag der Bundesregierung im Jahr 2023) den „Verein United 4 rescue“ mit 2 Mio. EUR als eine NGO jährlich finanziell unterstützt, was zur Verstimmung zwischen Italien und Deutschland geführt hatte https://taz.de/Fluechtlingspolitik-im-Haushaltsausschuss/!5894549/. Die Ministerpräsidenten Meloni hatte diese Art der Förderung illegaler Migration, die zu einem erhöhten Aufkommen von Migranten in Italien führt, scharf verurteilt und dies Bundeskanzler Scholz mitgeteilt; https://web.de/magazine/politik/deutsches-geld-seenotretter-meloni-schreibt-veraergerten-brief-scholz-38704932.
[26] Mehr dazu hier: Die 7 Todsünden – heute noch aktuell? https://www.guentherbirkenstock.de/neue-seite
[27] Eine kleine Anfrage der AfD ergab, dass allein gegen Frau Angela Merkel seit 2015 insgesamt 248 Strafanzeigen registriert wurden, bei denen in keinem Fall überhaupt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde; https://dserver.bundestag.de/btd/20/064/2006476.pdf
[28] Wolfgang Wodarg: Korruption – ein weltweites Phänomen, 58. Min. https://www.youtube.com/watch?v=p_wKXWEtKlg&t=4984s
[29] Wodarg a.a.O. 101. Min.
[30] https://www.guentherbirkenstock.de/gibt-es-eine-corona-verschwoerung ; https://www.guentherbirkenstock.de/was-koennen-wir-aus-der-corona-krise-lernen
[31] Matthias Nollke hat in seinem Buch „Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Handbuch der kleinen Sauereien“ eine schöne Sammlung vorgelegt, die illustriert, wie die Menschen doch den „inneren Schweinehund“ gerne herauslassen, wobei diese kleinen Sauereien oft mit „man darf alles nicht so eng sehen“ beginnen. https://www.amazon.de/darf-sich-nicht-erwischen-lassen-ebook/dp/B00W6AEE3Q